Mitautor und Mitherausgeber folgender Bücher mit wissenschaftlichem Anspruch:
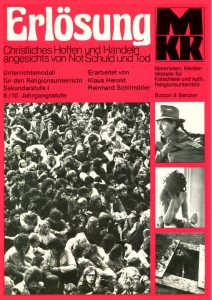 (vergriffen) (vergriffen) |
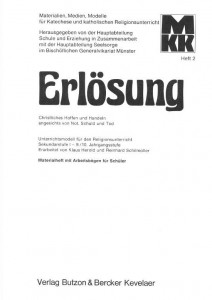 (vergriffen) (vergriffen) |
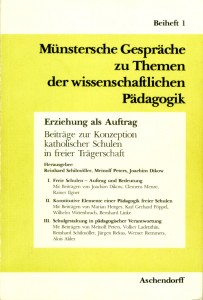 (vergriffen) (vergriffen) |
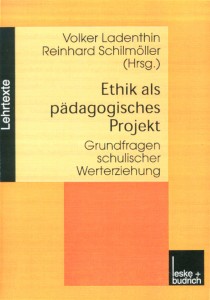 (vergriffen) (vergriffen) |
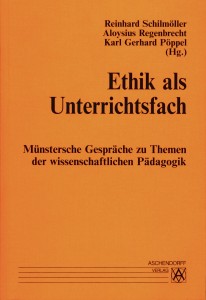 |
 |
 Wann verdient schulischer Unterricht das Prädikat »gut«? Ist der Unterricht dann gut, wenn er erfolgreich ist, also seine Ziele erreicht? Oder gibt es darüber hinausgehende Kriterien für die Güte des Unterrichts? Sind auch Prozessmerkmale von Bedeutung? Und wie lässt sich ihr Vorliegen feststellen? Sind alle oder nur einige Qualitätskriterien für einen guten Unterricht messbar und empirisch überprüfbar? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Antwort für die wissenschaftliche Bezugsdisziplin, die für den Unterricht zuständig ist? Kommt der Allgemeinen Didaktik oder der empirischen Lehr-Lern-Forschung eine Leitfunktion zu? Worin besteht jeweils ihre Leistung und wie lässt sich ihr Verhältnis bestimmen? Und welche Maßnahmen zur Realisierung eines guten Unterrichts lassen sich angeben?
Wann verdient schulischer Unterricht das Prädikat »gut«? Ist der Unterricht dann gut, wenn er erfolgreich ist, also seine Ziele erreicht? Oder gibt es darüber hinausgehende Kriterien für die Güte des Unterrichts? Sind auch Prozessmerkmale von Bedeutung? Und wie lässt sich ihr Vorliegen feststellen? Sind alle oder nur einige Qualitätskriterien für einen guten Unterricht messbar und empirisch überprüfbar? Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Antwort für die wissenschaftliche Bezugsdisziplin, die für den Unterricht zuständig ist? Kommt der Allgemeinen Didaktik oder der empirischen Lehr-Lern-Forschung eine Leitfunktion zu? Worin besteht jeweils ihre Leistung und wie lässt sich ihr Verhältnis bestimmen? Und welche Maßnahmen zur Realisierung eines guten Unterrichts lassen sich angeben?
Der vorliegende Band 26 der Münsterschen Gespräche zur Pädagogik versucht Antworten auf diese und weitere Fragen zu geben. Er dokumentiert die Ergebnisse einer Tagung, die in Kooperation mit der Akademie Franz Hitze Haus und dem Landeskompetenzzentrum für individuelle Förderung in Münster durchgeführt wurde. In den Beiträgen des Sammelbandes stellen bekannte Erziehungswissenschaftler ihre Position im Hinblick auf die genannten Fragen vor und beantworten erfahrene Praktiker die Frage nach Realisierungsmaßnahmen. Adressaten sind alle, die ein theoretisches oder ein praktisches Interesse an der Frage nach der Unterrichtsqualität haben: Wissenschaftler ebenso wie Bildungspolitiker und Schulaufsichtsbeamte, Lehrer und Schulleiter ebenso wie Fachleiter und Referendare, Schüler und Eltern.
Was ist guter Unterricht? Qualitätskriterien auf dem Prüfstand
Mit Beiträgen von Christian Fischer, Mechtild Frisch, Heinz Jürgen Ipfling, Regina Jacobs, Hermann Kleine-Büning, Daniel Kleine-Huster, Brigitte Koch-Höne, Ursula Krawinkel, Alice Lennartz, Elisabeth Mette, Hilbert Meyer, Helga Möllenbrink, Ulrich Pieper, Michael Ridder, Carsten Ritter, Reinhard Schilmöller, Elke Schwegmann, Ewald Terhart, Janine Twents, Anke Wilkens und Gerd Wilpert.
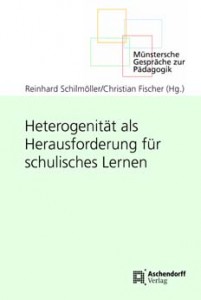 Die Heterogenität der Schülerschaft unserer Schulen nimmt unzweifelhaft enorm zu. Ergibt sich daraus nicht eine große Belastung für den Unterricht und eine kaum zumutbare Erschwernis für den Lehrerberuf? Diese Befürchtung stellt sich ein, weil eine möglichst große Homogenität der Schülerschaft bis heute als eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen schulischen Unterrichts gilt. Entsprechend homogenisieren und selektieren wir so lange, bis die gewünschte Homogenität erreicht scheint, stoßen dabei aber an Grenzen: Homogenität lässt sich kaum noch herstellen, war vielleicht immer schon eine Fiktion.
Die Heterogenität der Schülerschaft unserer Schulen nimmt unzweifelhaft enorm zu. Ergibt sich daraus nicht eine große Belastung für den Unterricht und eine kaum zumutbare Erschwernis für den Lehrerberuf? Diese Befürchtung stellt sich ein, weil eine möglichst große Homogenität der Schülerschaft bis heute als eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen schulischen Unterrichts gilt. Entsprechend homogenisieren und selektieren wir so lange, bis die gewünschte Homogenität erreicht scheint, stoßen dabei aber an Grenzen: Homogenität lässt sich kaum noch herstellen, war vielleicht immer schon eine Fiktion.
Was ist in dieser Situation zu tun? Es müsse ein radikaler Perspektivwechsel vollzogen werden, lautet die gegenwärtig viel diskutierte Antwort darauf: Heterogenität dürfe nicht länger als Belastung gewertet, sie müsse vielmehr als Chance begriffen werden, veraltete Formen frontaler Unterrichtung zu überwinden und stattdessen flächendeckend individualisierende Unterrichtsformen zu etablieren, mit denen sich dann im Sekundarbereich eine „Schule für alle“ gestalten ließe, die ohne Selektionen auskommt und alle Kinder gleich welcher Herkunft, Begabung und Gesundheit auf individuellen Lernwegen optimal fördert.
Die Beiträge des vorliegenden Themenbandes gehen auf wesentliche Fragen ein, die dieses Alternativkonzept aufwirft: Lässt sich empirisch bestätigen, dass nicht nur die schwächeren, sondern auch die stärkeren Schüler in der heterogenen Lerngruppe optimal gefördert werden? Wie muss ein individualisierender Unterricht gestaltet werden? Auf welche Praxisbeispiele kann man zurückgreifen? Ist es realistisch, von einer Zielerreichung für alle auszugehen? Mit welchen Veränderungen der „Schullandschaft“ ist zu rechnen? Die Antworten namhafter Autoren auf diese Fragen werden für alle interessant sein, die sich als Eltern, Lehrer, Bildungspolitiker, Wissenschaftler oder Studenten mit Fragen von Schule und Unterricht befassen und sich in der gegenwärtigen Diskussion um die Einrichtung von „Gemeinschaftsschulen“ eine begründete Position erarbeiten wollen.
Heterogenität als Herausforderung für schulisches Lernen
Mit Beiträgen von Helga Boldt, Alois Buholzer, Christoph Feder, Christian Fischer, Ulla Kreutz, Rainer H. Lehmann, Hildegard Michael, Reinhard Schilmöller, Martin Weyer-von Schoultz, Beate Wischer, Bernd Zymek.
